Geschätzte Wagner-Freundinnen und -Freunde, dear fellowers,
Wagner und die USA? Dochdoch, das geht – auch, soweit es sein eigenes Leben und nicht allein Mit- und Nachwelt betreffen.
Der Literaturwissenschaftler, Kulturkenner und Homme de lettres Hans Rudolf Vaget hat’s gerade in einem sehr schönen Buch gezeigt.
Buchkritik: „Richard Wagners Amerika“, Hans Rudolf Vaget
„Amerika, du hast es besser“ – das Wort stammt von Goethe, es gehört in den direkten Zusammenhang, auch wenn es von Hans Rudolf Vaget nicht zitiert wird. Dass in „Amerika“ – was heißt: in den USA – alles „besser“ sei: auch Richard Wagner hat sein ganzes Leben lang daran geglaubt. Kunststück: er hat seinen Fuß niemals in das Land gesetzt, konnte infolgedessen auch nicht enttäuscht werden, was unausweichlich der Fall gewesen wäre, hätte er nähere Bekanntschaft mit dem Kunst- und Business-Leben der Vereinigten Staaten gemacht.
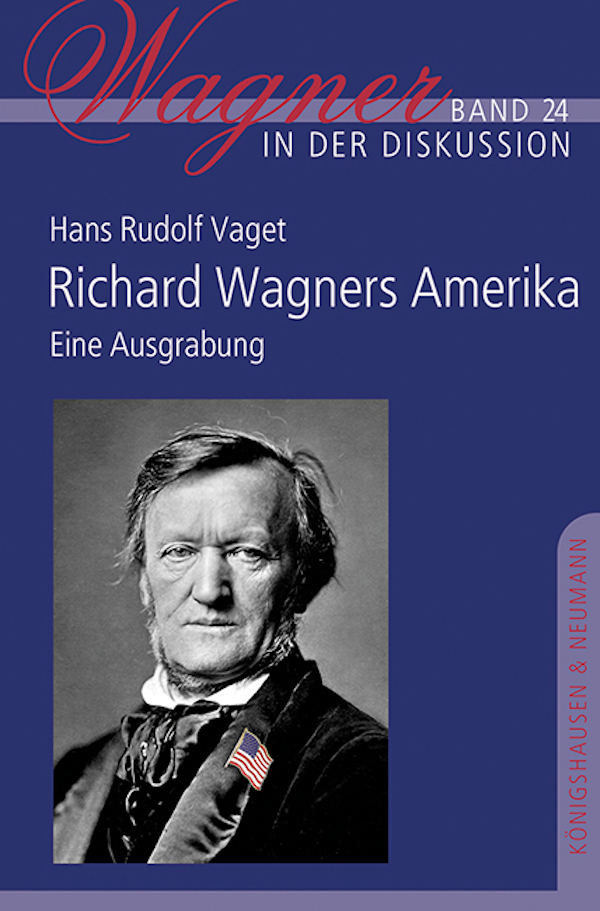
Wagner und Amerika: das Thema klingt vermutlich für die meisten Wagnerfreunde wie an den sprichwörtlichen Haaren herbeigezogen, auch wenn sie die gelegentlichen Erwähnungen des Halbkontinents in den Briefen des Komponisten zur Kenntnis oder die wenigen älteren, meist amerikanischen Aufsätze und Artikel, die seit 2019 in der monumentalen Wagner-Bibliographie von Steffen Prignitz gelistet wurden, oder in den letzten zehn Jahren das wagnerspectrum gelesen haben. Tatsächlich war, wie Vaget umstandslos zu schließen vermag, Amerika (wie gesagt: immer verstanden als USA) dem Europäer, der Wagner immer blieb, ein „heimlicher Sehnsuchtsort“: von den ersten Reflexionen in der Jugendzeit bis in die letzten Monate seines Lebens. Bislang wurde das durchaus nicht randständige Thema aus dem scheinbar unerschöpflichen Wagner-Kosmos noch nicht in einer zusammenfassenden und theorie- wie beweisstarken Abhandlung zusammenfassend erläutert. Vaget, dem wir bereits einige profunde Studien zumal zu Wagners Wirkung in den USA verdanken, war bis 2004 Professor of German Studies and Comparative Literature am Smith College in Northhampton; seine Zuneigung und intime Kenntnis des Gegenstands erwächst aus dem glücklichen Umstand, dass er in den beiden Kulturen gleichermaßen zuhause ist – denn über „Wagners Amerika“ nachzudenken, bedeutet mehr, als einen Essay über „Wagner und Amerika“ zu schreiben. Vielleicht ist es die örtliche Distanz gewesen, die Vaget die Idee eingab, einmal ein Thema zu reflektieren, das im Licht einer eurozentrierten Annahme von Wagners „Deutschtum“ allzu sehr bagatellisiert werden könnte. Tatsächlich wäre ein Wagner, der seinen mehrmals vorgebrachten Plan umgesetzt hätte, in die Staaten auszuwandern, das denkbar schlechteste Aushängeschild für die Propagierung eines nationalen Superstars gewesen. Mit Blick auf die Wirkung, die Wagners Werke schon sehr früh, konkret: bereits in den frühen 50er Jahren, in den Musikensembles der deutschstämmigen communities und den schon damals populären „Wagner NIghts“ erfuhren, erweist sich jedoch wieder einmal der übernationale Mehrwert des Wagnerschen Werks – mag auch Wagner selbst der (zeittypischen) Überzeugung gewesen sein, dass allein am deutschen, genauer. dem Wagnerschen Musikwesen die (US-amerikanische) Welt genesen könne.
Von Letzterem zeugt eine bekannte, aber zumindest bei „uns“ bislang so gut wie nicht zur Kenntnis genommene autobiographische Schrift, die zwar nicht von Wagner geschrieben, aber ausdrücklich autorisiert wurde. Vaget interpretiert – schon diese philologische Tat ist verdienstvoll – Hans von Wolzogens „The work and mission of my life“ und macht erstmals die Dimension und die Hintergründe dieses viertelapokryphen Wagner-Texts deutlich. Der Kontext ist nur allzu klar: Wagner pflegte von je her ein idealistisches Amerika-Bild, dem auf der anderen Seite des Ozeans die höchst engagierte Wagner-Pflege entsprechen mochte. Mehr noch: das Konzept des „Ring des Nibelungen“ verführt den Interpreten zur Aussage, dass es sich bei der Tetralogie um Wagners „amerikanischstes Werk“ handele. Dies nicht, weil es hier um den Mammon geht, über den manch Gold-Digger sich seine eigenen Gedanken machte, sondern weil für den linken Theoretiker vom Schlage der nach Amerika emigrierten „Fourty-Eighter“ die Vision eines von Machtzwängen „freien Volks“, wie es im „Faust II“ vom „Helden“ visioniert wird, in den USA einlösbar schien. Vaget verfolgt also Wagners Amerika-Bild von den theoretischen Schriften, in denen Kolumbus (dem Wagner eine Schauspiel-Ouvertüre widmete) und Beethoven und schließlich Wagner (der Entdecker einer neuen Kunst-Welt) parallelisiert werden, über das „amerikanisch sein wollende“ Valse-Motiv der Blumenmädchen bis zu den finalen Auswanderungsfantasien – es waren, Vaget kann das genau nachweisen, eher Druckmittel gegen einen wankelmütigen königlichen Mäzen als ernsthaft verfolgte Pläne. Trotzdem fällt auf, dass die Idee einer besseren Staatsverfassung noch in den Gedanken widerhallt, die Wagner sehr pragmatisch Richtung München entließ. Mit „Amerika“ ließ sich dem Wittelsbacher auf dem Fürstenthron stets sehr gut drohen.
Zu den Zugewinnen des relativ schmalen, doch ergiebigen Bandes, der dünner ausgefallen wäre, hätte der Autor all jene Teile gestrichen, die sich um Ludwig II., doch nicht um Amerika selbst drehen, zu den schönsten Seiten des Buchs gehören, einschließlich des Abdrucks des relevanten Kapitels aus Jenkins‘ amerikanischer Autobiographie, aller Jenkins-Wagner-Widmungen und des erstmals philologisch korrekt publizierten Auswanderungs-Briefs Richard Wagners, die Studie über Wagners Zahnarzt Newell Sill Jenkins. Genaueres über diesen interessanten Mann aus Wagners späten Jahren wird man nirgendwo in der Wagner-Literatur finden. Für das Werk bleiben Vermutungen wie folgende reizvoll: „Die Leidenstöne, die ‚Parsifal‘ sein unverwechselbares Gepräge geben, mögen wenigstens zu einem kleinen Teil der in der Zahnbehandlung gestählten Leidensfähigkeit Wagners geschuldet sein.“ Gleichzeitig schrieb Wagner ein Opus, das direkt mit den USA zusammenhängt und heute wohl nur von wenigen Wagnerfreunden gekannt resp. geschätzt wird. Dabei hat der American Centennial March zur 100. Geburtstagsfeier der US-Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung seine Meriten. Vaget referiert die Premieren- und unmittelbare Rezeptionsgeschichte – und weist nicht auf das Naheliegende hin: dass im lyrischen Thema Gutrunes Musik deutlich widerhallt.
Diese Leerstelle, die das sog. (bei Wagner, da hat Vaget völlig recht, immer interessierende) „Nebenwerk“ mit dem Hauptwerk verbindet, ist kaum fühlbar. „Veronika – Amerika“, dieser nur auf den ersten Blick kuriose Reim, der sich in einem Brief von 1853 befindet (der Fall wurde im wagnerspectrum 1/2021 aufgeklärt), wird nicht zitiert. Diese Kleinigkeiten vermögen nicht das Vergnügen am Buch zu schmählern, das diesen „markanten Zug seiner (Wagners) geistigen Physiognomie“ zum ersten Mal, auch mit einer hilfreichen Zeittafel nachzeichnet. Es sind denn doch nicht ganz wenige Zeugnisse, die an Wagners Amerika-Begeisterung Teil haben, in der sich die Sehnsucht nach einem gelungenen Leben in fremdem, von den Verderbnissen der Zivilisation noch unbeschädigten Land manifestierte.
Es muss also absolut nicht verwundern, dass Wagner zwischendurch von einer Uraufführung des „Ring“ und des „Tristan“ an den wilden Gestaden des Mississippi träumte.
Frank Piontek, 18. April 2023

