Liebe Wagner-Freunde,
diese Festspiele sind anders – aber nicht uninteressanter als andere. Denn mit dem vom Diskurs Bayreuth veranstalteten Ring 20.21 gelang in Bayreuth etwas durchaus Ungewöhnliches. Zumindest mir hat er in allen Einzelteilen, die sich zum Ganzen rundeten, sehr gefallen.
Mehr darüber können Sie in meinen vier Rezensionen lesen, die ich gerade auf der Seite deropernfreund.de veröffentlicht habe – falls Sie mehr Bilder als die vier, die ich gerade anhänge, sehen wollen, sollten Sie sich die Seite anschauen.
Beste Grüße aus Richard-Wagner-Stadt
Frank Piontek



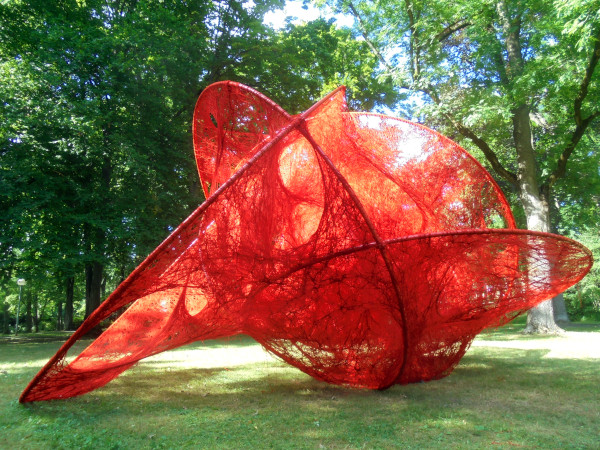
Diskurs Bayreuth: Ring 20.21
DAS RHEINGOLD – IMMER NOCH LOGE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 1)
Uraufführung: 29.7. 2021
Wer ist Loge? Ist er ein gescheiterter Aufklärer oder ein skrupelloser Intellektueller, ein Opfer oder ein Täter
des Systems Wotan? Teil 1 des außergewöhnlichen Ring-Projekts des diesjährigen Diskurs Bayreuth, dessen
Ergebnisse nur schwer zwischen zwei Buchdeckeln zu vereinigen sein werden (wir freuen uns darauf),
beantwortet die Frage auf eine Weise, die den Ring, genauer: das Ring-Finale weiterdenkt; gegenüber kann
der Besucher des Festspielhügels die Götterdämmerungs-Installation Chiharu Shiotas bewundern, betrachten
und umrunden. Gegenüber, das heißt: dem Teich im Festspielpark entgegengesetzt, an dem, topographisch
höchst passend, nach dem Ende des Endes Immer noch Loge eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage
zu geben versucht. Den musikalisch-spielerischen, 60 Minuten kurzen Vormittag haben drei Männer
entworfen, die für ihre Kunst gleichsam brennen: der Librettist Paulus Hochgatterer, der Komponist Gordon
Kampe und der Puppenmacher und -spieler Nikolaus Habjan.
Wagner-Puppenadaptionen zumal im Ring-Bereich sind nicht neu; zwei Tage nach der Premiere von Immer
noch Loge wird ein Ring-Figurentheater in Bayreuth gastieren, vor 30 Jahren verfilmte das hiesige WolleWürfel-Figurentheater die Tetralogie, es existieren mehrere animierte Ring-Filme, ja: man könnte
inzwischen ein Buch zum Thema „Wagner und das / im Figurentheaterspiel“ machen. Der Ring eignet sich
vielleicht deshalb so gut für diese vielfältige Spiel-Art, weil die fantastischen Figuren ein Kasperletheater
höherer und höchster Ordnung geradezu provozieren: nicht nur in Hinblick auf Siegfried als Krokodil-,
pardon: Drachentöter. Nun also entwarf man ein Endspiel, um es am geeigneten Ort zur Uraufführung zu
bringen – denn die Rheintöchter durch den Teich schwimmen zu lassen ist so naheliegend wie betörend.
Habjans Rheintöchter aber sind keine erotisch reizenden, sondern blau schimmernde, kalte Wasserwesen, die
es lieben, wie Gollum die Fische aufs Wasser zu schlagen, um sie zu töten. Die Szene spielt nach dem
Walhallweltbrand, die uralte Erda, persönlich gespielt vom Meister der Klappmaulpuppen, im Rollstuhl auf
einem langen Steg sitzend (Bühne: Julius Theodor Semmelmann) hält Gericht über den gefangenen
Feuergott, dessen Elementarwirkung kaum etwas Anderes als Asche hinterließ. Ist er schuld daran? War er,
als „Plappermaul“, der „Brandstifter“? Ist er verantwortlich für das Welteschensterben? Wo die Welt stirbt
und der Ring zur ökologischen Parabel auf den drohenden Weltuntergang wird, scheint Immer noch Loge
Partei zu nehmen gegen den Gott, der noch vor Gericht das Spotten nicht lassen kann; Kampes Musik
begleitet alle Nuancen und alle pauschalen dramatischen Affekte des Texts mit einer Souveränität, die das
Dunkeldräuende und das Populäre umfasst. Wir hören Rezitative, Arioses, Terzette und Couplets, Walzer
und tänzerische Viertakter, eine Elegie im Sechsachteltakt („Was bleibt übrig, wenn Helden verbrennen?“)
und, auf Loges „Neid“-Tirade, ein buffoneskes Parlando. Wo Wagner – in Text und Musik – ausdrücklich
zitiert wird, geschieht‘s allein aus juristischen Gründen: „Welchen Handel hätt ich geschlossen“, also Loges
Frage an den vertragsverzweifelten Wotan. Nur sieben Musiker genügen, um eine pralle KammerorchesterPartitur zu realisieren, in der doch jedes Instrument als individueller Solist hörbar ist: Violoncello und Bass,
Klarinette und Bassklarinette, Horn und Trompete, Posaune und Schlagzeug – letzteres begleitet Erda, nach
dem initialen Es des Grundrauschens des Vorspiels dieser Loge-Geschichte bis zum Ende, in dem die letzten
Töne der Kuhglocken im Nichts verhallen. Doch ist es nicht, wie‘s im Libretto steht, die Göttin, die übrig
bleibt. Wird Loge bei Hochgatterer mit einem Fisch gestopft und sodann in seinem Käfig angezündet, darf
er bei Habjan die Urmutter zudecken und die für sie vorgesehenen letzten Worte singen: „Sie lächelt. Seht
ihr sie lächeln?“ Womit schon mit der ersten Aufführung des neuen Werks die zentrale Aussage des
Schlusses ins Gegenteil verkehrt, vielleicht, wie Ernst Bloch gesagt hätte, „zur Kenntlichkeit entstellt wird“:
denn Hoffnung auf einen gerechten Ausgang des Welt-Prozesses scheint es nicht mehr zu geben, weil
Feuergötter sich im Feuer besonders wohl zu fühlen pflegen.
Rein technisch machen Habjan und seine beiden Puppenassistenten (Clara Rybaczek und Stephan Q.
Eberhard) das hinreißend. Den Teich im Festspielpark werden sich die Zuschauer zukünftig kaum anders
vorstellen als von leicht gruseligen Rheintöchtern bevölkert, von denen die dritte ziemlich tot erscheint und
als hilfloses Bündel von ihren beiden Schwestern mitgezogen wird; wenn Daniela Köhler sie lange im Arm
hält, begegnen sich Figur, Mensch und Sänger so wie Erda und Stephanie Houtzeel, die eine wunderbare,
warm intonierende Mezzo-Erda singt und – „Der Weltenbrand! Der Weltenbrand!“ – plötzlich wie eine
aufgeregte Prophetin auf- und zur Puppe springt, um mit ihr zusammen zu sein. Später wird auch der dunkle
Bariton Günter Haumer seine konzertante Komfortszene verlassen, um ins Wasser zu steigen und sich ein
wenig später in Windeseile in Loge zu verwandeln, der das letzte Wort haben wird. Wer also ist Loge? Ein
„Zündler“, so Habjan, der immer zu überleben scheint, auch wenn er in einem Sarg lebt, in dem er sich auf
Aschenhaufen bettet. Nennt man Loge auch „Lüge“, so ist er doch auch dafür gut, ein groteskes wie am
Schnürchen ablaufendes musikalisches Puppenspiel provoziert zu haben, das nach dem leisen Schlussakkord
– und dem mehr als freundlichen Applaus – in seiner realen Entsprechung so schnell kein Ende finden wird.
Frank Piontek, 29.7. 2021
Fotos: ©Bayreuther Festspiele / Enrico Nawarath
DIE WALKÜRE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 2)
Premiere: 29.7. 2021. Besuchte Vorstellung: Generalprobe, 23.7. 2021
Während die Wagnersche Harmonik zwischen Gewesenem und Zukünftigem schwankt, ist die koloristische
Dimension recht eigentlich von ihm entdeckt worden.
Theodor W. Adorno: Versuch über Wagner. V: Farbe.
Dass Hermann Nitsch, der Großmeister der Aktionskunst, der Zeremonienmeister der Prinzendorfer
Schlacht-Festspiele, einmal mit einer „Malaktion“ in Bayreuth auftreten würde, war spätestens zu erwarten,
seit er in einigen Opernhäusern Stücke ausstattete und aktionistisch bereicherte, die zu seinem persönlichen
Stil zu passen scheinen: Massenets Herodiade und Messiaens St. Francois d‘Assise eignet auf je
verschiedene Weise etwas, was einen alten Leben-und-Tod-Mystiker wie Nitsch in den Bann ziehen musste.
Dass er einmal eine Parsifal-Aktion veranstaltete, war kein Zufall, wenn auch noch keine direkte Bewerbung
für eine mögliche Inszenierung des „Bühnenweihfestspiels“ in der Gralsburg der Wagnerianer selbst. Dass er
nun spät, doch wohl nicht zu spät am Ort in Erscheinung tritt, indem er seine Mitarbeiter am Heiligen Werk
auf der Bühne des Festspielhauses agieren lässt (und sie vom rechten Inspizientenpult aus dirigiert), ist
somit fast folgerichtig, auch wenn‘s „nur“ Die Walküre, nicht Wagners „letzte Karte“ ist.
Bildende Kunst und Oper: die Begegnung ist nicht neu, sondern spätestens seit der Moderne erprobt, wobei
die Frage stets war, ob der Maler oder Bildhauer (wie Alfred Hrdlicka, der den Meininger Ring skulptierte)
einen Beitrag zum Gesamtkunstwerk liefert oder eine eigenständige Position einnimmt. Die Zuschauer, die
die Generalprobe der ungewöhnlichsten Bayreuther Walküre aller bisherigen Zeiten erleben konnten,
einigten sich darauf, dass Nitschs Beitrag zum Musikdrama “nicht gestört“ hätte – wer länger über den
Abend nachdenkt, wird zum Ergebnis kommen, dass die Meinung zwar nicht ganz falsch, aber ungerecht ist:
denn ein Zusammenklang zwischen Bühnenaktion, Musik und Bild musste unausweichlich entstehen, wenn
man es nicht vorzog, die Augen zu schließen. Immerhin birgt die versöhnliche Aussage das Urteil, dass die
ungewöhnliche Kombination von viertelszenischer Aufführung der Walküre und gleichzeitiger Herstellung
mehrerer Schüttbilder einen eigenen Reiz hatte, der das Kunstwerk Oper nicht beschädigte, freilich auch
nicht en detail berührte. Dass Wagner selbst die Aktion in einem mindestens 50 Seiten langen Aufsatz
vehement abgelehnt hätte, weil unterm Strich kein „Gesamtkunstwerk“, sondern – in Brechtschem Sinn –
bisweilen eine mehr oder weniger deutliche Trennung beider Sphären entstand, macht das Unternehmen
nicht obsolet. Im Gegenteil: Die Berührungen zwischen der Farbe, den Farben und der Dramaturgie des
Werks zu beobachten, ist äußerst spannend. Ohne gleich von „Synästhesie“ zu reden, darf Nitsch zitiert
werden: „die malvorgänge sollen wie musik sein. Klänge werden zu farben“. Was hier entstand, war
durchaus neu, auch wenn kein neuer Blick auf die Walküre selbst erwartet werden konnte – allein die
persönliche Deutung eines Künstlers, der es liebt, in Farben zu schwelgen und sich auf das Abenteuer
einließ, sich live von Wagners Musik inspirieren zu lassen, um zu belegen, dass sich das orgien mysterien
theater vom früheren Gesamtkunstwerk direkt ableitet.
Die Wahl der Farbe hängt von keiner Regel ab. Das koloristische Moment, über das Wagner in voller
Freiheit gebietet, ist zunächst die Domäne seines Subjektivismus.
Adorno
Auftritt der Sänger. Sie tragen weite schwarze, leicht wallende Gewänder, die die Erinnerung an den großen
Wiener Maler Gustav Klimt wachrufen. Mit dem ersten Takt beginnt Nitschs Mannschaft zu schütten: von
oben, acht Meter hoch, läuft die Farbe langsam hinab. Unten macht es vernehmlich „Schwapp“, wenn die
untere Fläche beschüttet wird. Grün, blau, violett, das sind die Farben der Natur, die Nitsch dem
Wälsungenpaar schenkt, grün und blau sind die Farbakzente fast des gesamten ersten Akts. Der Rezensent
denkt an eine der legendären Regieanweisungen Fritz Kortners: „Mehr grün!“ – aber mehr Grün geht kaum,
bevor in einem der wenigen, aber sehr genauen Wechsel der Farbakzente der „Wonnemond“ in Blau
erstrahlt. Nitsch interpretiert die dramaturgischen Wendepunkte der Walküre auf eine Weise, die vermuten
lässt, dass die Farbpunkte und -akkorde, die an Kandinskys Farbmetaphysik denken lassen, auch anders
gesetzt werden können. Dennoch ist hier alles logisch – beginnt Wotans Monolog in tiefem Blau, was
Ausdeutungen in Richtung Königtum möglich macht, wird die Rückwand schon schnell in ein sattes,
leuchtendes Schwarz gesenkt: Alberichs Heer der nächtlichen Nibelungen ist dunkel, nicht leuchtend wie
eine Todverkündigung, die in Gelb gemalt wird (dass die Compagnie des knappen Dutzends Malergehilfen
wie ein kleines Nibelungenheer erscheint, hat an diesem Abend seinen eigenen Witz). Der Verlauf – in
Zusammenhang mit den von oben geschütteten Farbstreifen hat das Wort einen Doppelsinn – organisiert
sich bei Nitsch nach einigen wenigen, aber überzeugenden Crescendi, Decrescendi und nochmaligen
Steigerungen; am Ende des 1. Akts tritt, nachdem das Blau der Natur aufstrahlte und sich wieder
abschwächte, endlich, es muss einfach bei Nitsch in Erscheinung treten, ab „Siegmund heiß ich“ ein
kräftiges Rot: als Signum der Vitalität des (Wälsungen-)Bluts.
Beginnt der vitalistische 2. Akt mit einem strahlenden Farbklang aus Gelb und Orange, einer
Farbsymphonie, in der das Blau zunächst noch ausgeschlossen ist, erglänzt die Götternot in Grau, dann in
Schwarz – Helligkeit kommt erst wieder ins Spiel, wenn Wotan sich mit Brünnhilde über Siegmund streitet:
ein Hoffnungsstrahl am Horizont, Rosa und Grün besiegen die Finsternis, Siegmund und Sieglinde sind
weiß, nichts als weiß (so weiß wie der Tenor, der den einzigen wahren „Helden“ der Tetralogie an diesem
Abend singt). Und rot ist, natürlich, der Kampf, der den Helden fällt; das Blut wird diesmal geschüttet, nicht
vergossen.
… in der Art, dass jene Farbe selbst zur Aktion wurde.
Richard Wagner: „Zukunftsmusik“
Es eröffnet auch den dritten Akt, der die Walküren rot, sehr rot ausstattet. Bevor es schließlich den letzten,
gewaltigen Farbakzent des Feuerzaubers macht, dürfen Sieglinde, in einer der auratischsten „Stellen“ des
Ring , im symbolischen Grün der Hoffnung schimmern und die Walküren in Weiß abgehen. Erregt Wotan
sich immer mehr gegen die abtrünnige Tochter, wird das Schütten merklich mächtiger, grün, mehr grün
(denkt der Besucher), ein Violett, das die Erinnerung an die Frauenbewegung wohl unabsichtlich provoziert,
leitet über zu Nitschs Haupt- und Lieblingsfarbe – um die Wand auch im unteren Drittel ins Tiefrot zu
setzen, wird nun – ab „Du zeugtest ein wildes Geschlecht“ – von unten geschüttet; der Feuerzauber glüht
höchst vernehmlich von der Wand, über der immer wieder Nitschs Assistenten erscheinen, um ihre Kannen
an den Rand zu setzen. „er war immer mein lehrer“, schreibt nitsch im programmheft. Auf der Bühne sieht
man die Schüler des Schülers am heiligen Werk.
die innerhalb des spieles ästhetisch sich verwertende abreaktion macht die ursache von individuellen
neurosen bewusst.
Hermann Nitsch
Erscheint die Bühne mit ihren gewaltigen zwei horizontalen und vertikalen Malertafeln wie ein bespieltes
Gemälde, so agieren die Sänger so, wie man es von konzertanten Aufführungen kennt: andeutungsweise
interagierend. Es herrscht ein Berührungsverbot, die Walküren stehen, seltsam zu sehen, stocksteif, als
sängen sie ein Oratorium. Wenn Siegmund Sieglinde zart an den Wangen berührt, ist‘s eine Sensation. Aus
der Zeichnung, die in Wagners Musik ein vollkommenes Bild ist, wird plötzlich ein Gemälde. Wie eine
Befreiung der Szene wirkt es auch, wenn Brünnhilde sich begeistert dazu entschließt, Siegmund zu retten
und gleichzeitig, als szenischer Kontrapunkt, eine weißgewandete Frau mit verbundenen Augen, eben eine
typische Nitsch-Performance-Frau, auf ein Kreuz montiert, von vier Assistenzfiguren aufgerichtet und
sodann, natürlich, mit roter Farbe übergossen wird. Antikes Opfer, Christentum und Wagner scheinen einen
Moment lang eins, die Aneignung ist so willkürlich wie vollkommen. Man hatte es erwarte und zugleich
nicht erwartet – das Beste aber kommt zum Schluss: wieder wird eine auf ein Kreuz gebundene Frau
hineingetragen, dann wird ein Mann mit verbundenen Augen hineingeführt, dessen einzige Aufgabe darin
besteht, eine Monstranz zu halten. Das Grandiose, schwer Deutbare, geschieht. Bei Wotans emphatischer
Anrede an die Tochter, die er gleich, wie ein anderes Opfer (Siegmund war das erste), zur Ruhe legen wird,
also bei „Deiner Augen leuchtendes Paar“, wird die Monstranz gehoben und präsentiert. Und wie zum
Beweis, dass es bei Wagner stets eine Identität von Musik und Geste gibt, senkt sie sich beim Erklingen des
Schlafmotivs.
Wie auch immer die radikale Katholisierung der Opfergeschichte von Siegmund und Brünnhilde zu
beurteilen ist: die szenischen Einschnitte, die Hermann Nitsch hier vornahm, wirken, ja: sie wirken stark und
dezidiert.
Die Bilder werden bleiben
Christoph Schlingensief: Parsifal, Bayreuth 2004
Zugegeben: Manchmal, genauer: ab dem zweiten Akt agieren die Sänger so stark, dass die Bilder unwichtig
werden und noch mehr in den Hintergrund rücken, als sie eh schon stehen und liegen. Mag sein, dass dies
mit dem Wort gemeint war, dass sie „nicht stören“ würden. Tatsächlich ist es über weite Strecken
unmöglich, den Zusammenhang zwischen Bild/Farb/akkord und Musik/Drama zu bemerken – völlig
unabhängig davon, ob ein wirklicher Zusammenhang besteht oder die Schüttung auf einer anderen Ebene
buchstäblich verläuft als das, was gerade akustisch und viertelszenisch geschieht; nicht vergessen werden
darf allerdings, dass schon die Schütt-, Wisch- und Herumlaufgänge und -krauchereien der Farbassistenten
einen szenischen Charakter besitzen, der an die von der „eigentlichen“ Walküre-Handlung unabhängigen
buchstäblichen Aktionen der Statisten erinnert, die in Frank Castorfs unvergesslicher Bayreuther
Inszenierung die Bühne als russische Revolutionäre bevölkerten. Was in Nitschs Walküre-Interpretation – es
war eine – bleiben wird, ist die Gewalt zweier Farbflächen pro Akt, die sich dem Drama erstaunlich eng
anschmiegten, ließ man sich erst einmal auf die Langsamkeit ein, mit der die Wechsel der Farbakzente und –
mischungen vor sich gingen – aber auch Wagners Dramaturgie zeichnet sich ja nicht gerade durch rasante
Schnelligkeit aus.
Der Sänger sitzt.
Fritz Kothner
So waren sie zugleich das Wichtigste und seltsam unwichtig, je nachdem, ob man sein Augenmerk nun aufs
Optische (die Flächen) oder das Akustische (die zunächst ruhig dasitzenden Sänger und ihre gestischen
Beiträge) konzentrierte. Wie gesagt: ab dem 2. Akt war zumindest mein Fokus oft eher bei ihnen als bei der
Bildkunst. Lag es an Klaus Florian Vogt, dass dem so war? Zweifellos interessierte man sich im Anfang des
Dramas zunächst für das natürlich spektakuläre Andere des rückwärtigen Bild-Aufbaus. Dass Vogt ein
Sänger ist, dessen Stimme relativ wenig Dramatik gestaltet, aber mit seinem weißen Klang vorbildlich
artikuliert und scheinbar mühelos die Höhen zu gestalten weiß: es sind die Pluspunkte seines Singens, die,
rollencharakterbedingt, vermutlich allein im Lohengrin zur völligen Erfüllung findet. Lise Davidsen, deren
überaus strahlender Sopran wie mit altem dunkelrot-violettem Edelsamt bedeckt ist, was ihrer Stimme,
vergleicht man sie mir der einer Kirsten Flagstad, einen unvergleichlich „alten“ und doch unfassbar vitalen
Klang verleiht, ist in Bayreuth seit ihrem sensationellen Einstieg als Elisabeth bekannt. Sie gestaltet die
Sieglinde zwar pur innerlich, doch gleichzeitig mit einem blendenden Klang, der im dritten Akt mit
dreifachem Forte über ein nötiges Maß hinausgeht; weniger wäre an den exponierten Stellen ihrer Szene
tatsächlich mehr. Über Irene Theorins Brünnhilde kann nur gesagt werden, dass ihre Stimme, wie Thomas
Mann geschrieben hätte, „mit historischem Edelrost“ überzogen ist, während Günther Groissböck in seinem
Bayreuther Wotan-Debüt und seiner gleichzeitig vorerst letzten Bayreuther Wotan-Vorstellung entzückt,
weil er Schönklang, genaue Artikulation und dramatische Kraft ineins bringt und noch den Schluss – bei
aller Kraftanstrengung – gestalten kann: ein wütender, von seiner Tochter begeisterter, herrischer und
verzweifelter Wotan, eine Prachtfigur. Bleiben die gute Fricka der Christa Meyer, der Hunding des Dmitry
Belosselskiy: ein hervorragender finsterer Bass, wie man ihn auch in Bayreuth nicht alle Jahre hören kann,
und das Corps der Walküren, die im Gesamtklang eine außerordentlich schöne, reintönende Mischung
produzierten. Getragen wurden sie vom Orchester der Bayreuther Festspiele, das unter Pietari Inkinen eine
bewegte, subtile, klanglich schöne und doch nachdrücklich dramatische Walküre aus dem Graben
herausspielt. So gehört, darf man sich auf den gesamten Ring freuen, der hoffentlich im nächsten Jahr auf
die Bühne kommen wird – ohne Farb-Spiele, aber mit anderen koloristischen Interpretationen.
…bietest mein Bild mir nun du!
Sieglinde
Einmal dreht sie sich doch um. Siegmund singt, der Mond strahlt in das Haus, das vordem dunkel war, den
kommenden Frühling der Liebe an: „Siehe, der Lenz lacht in den Saal“, und Sieglinde, also Lise Davidsen,
dreht sich zum ersten und letzten Mal zum BILD um: als blickte sie in ein Atelier, in dem gerade eine
gewaltige Fläche mit grünen, braunen und violetten Farbstreifen zu einer Komposition wird. Die Drehung
erscheint plakativ, fast ist sie zu deutlich, aber als augenzwinkender Hinweis auf das, was da gerade im
Wonnemond innerlich, aber auch äußerlich buchstäblich ausgemalt wurde, ist sie einfach: zauberhaft.
Fotos: ©Bayreuther Festspiele / Enrico Nawarath
Frank Piontek, 24.7. 2021
SEI SIEGFRIED (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 3)
Premiere: 29.7. 2021. Besuchte „Vorstellung“: 17.22, Counter 6
Wotans Raben fliegen schon unheilankündigend durch den Saal. Ich befinde mich im Festspielhaus.
Donnerstagnachmittag, fremde Mächte haben mich ins Haus gelockt, es sieht nicht so aus, als würde hier
gleich der zweite Akt des Siegfried stattfinden. Zuerst stand ich vor der berühmten Tafel mit den Namen der
Mitwirkende der ersten Bayreuther Festspiele, dann sah ich mich unversehens ins rechte Foyer versetzt, und
sogleich war ich im Zuschauersaal – der Blick auf die Bühne verhieß nichts Gutes. Dort glimmt es
unheimlich, wie aus einer todverheissenden Höhle heraus, als mir in Reihe 5 ein Mann entgegentritt, der mir
die Ankunft Fafners verhieß. Ich kann gar nicht so schnell Angst haben wie ich IHN erblicke: das Monster
fliegt kampfeswütig durch den Raum, in dem ich sonst mit vielen anderen Zuschauern zu sitzen pflege. Es
bleibt mir nichts Anderes übrig, als zum Schwert zu greifen, das für mich bereit liegt. Dann beginnt – ich
kenne ja die Oper – schon schnell der Kampf. Es hilft nichts: ich muss Siegfried sein und den grausam
grimmigen Kerl ermorden. Die Musik dröhnt in mein Ohr, der riesige Drache nähert sich, speit Feuer, es
raucht und brüllt aus ihm heraus, doch als der Befehl erscheint Erschlage den Drachen, stoße ich beherzt zu.
Das Untier wird in den Raum geschleudert, das Schwert im Herzen, ich sehe, wie oben die Säulen brennen,
der monströse Drache stürzt nieder, direkt zu meinen Füßen, ich könnte den gigantischen Schädel berühren,
ich triumphiere: „Da lieg, neidischer Kerl…“. Einen Augenblick später stehe ich in einer der hinteren
Reihen des Zuschauersaals und sehe den gewaltigen Körper, wie er sich sterbend über den Orchestergraben
wälzt – und schon bin ich erlöst. War es mein Herz, das ich im Eingang zum Festspielhaus deutlich heftig
vor mir schlagen sah? War es das von Fafner, den ich gerade gekillt habe? Egal – einige Minuten lang war
ich das Kind, das das Fürchten nicht gelernt hat (denn ich kenne ja die Oper).
Sei Siegfried, so heißt die nicht einmal fünf Minuten lange Arbeit, die im Rahmen dieser etwas anderen
Tetralogie 20.21 für einen ganzen Opernabend einsteht. Die Idee, die vielleicht nicht allein bei jugendlichen
Zuschauern beliebteste Szene des Siegfried in ein Virtual Reality-Spiel zu verwandeln, war schon im
Hinblick auf einen bedeutenden Wagner-Deuter gut. Thomas Mann war nicht der erste, der die Ähnlichkeit
des germanischen Helden mit dem „Pritschenschwinger“ Kasperl und die Nähe Fafners zum Krokodil
bemerkte. Wagner selbst liebte das Figurentheater, an dem die kleinen Zuschauer durch Zurufe und
Mitfiebern einen besonderen Anteil nehmen – Sei Siegfried realisiert mit den ausgefuchstesten Mitteln der
modernen Digitaltechnik eine Simulation, in der sich der Besucher des Festspielhauses wie ein Kind fühlen
kann, das den Zuschauersaal des Festspielhauses als unheimlichen „Erlebnisraum“ durchkämpft. Man
könnte es auch auf einen einzigen populären Begriff bringen: „Geil“ – denn die Professionalität, mit der der
Wagnerianer hier den äußerlich dramatischen Höhepunkt der geliebten Oper erlebt, ist nichts als das. Die
Idee, den Kampf im Saal stattfinden zu lassen, schon deshalb von schlagender Originalität, weil damit
Wagners Ursprungsidee, die Festspiele dem sog. Volk zugänglich zu machen, für einige wenige, aber
packende Minuten (virtuelle) Wirklichkeit wird – vorausgesetzt, man hat das Glück, eine Eintrittskarte für
eine der drei Walküre-Malaktionen zu besitzen, in deren Pausen und eine Stunde danach den angemeldeten
Opernbesuchern die Brillen übergestülpt werden. Die realen Schwerter, die zwischen den sechs „Counters“
zahlreich auf dem Boden liegen, sind dagegen nicht mehr als nostalgische Theaterrequisiten einer
vergangenen Epoche. Wozu braucht man schon eine Eisenwaffe, wenn man einen Helm des 21. Jahrhunderts
auf dem Kopf trägt?
Wir verdanken diesen kurzweiligen und aufregenden Beitrag zum Ring 20.21-Projekt des Diskurs Bayreuth
dem auf vielen Gebieten ungewöhnlich vielseitigen Theaterregisseur Jay Scheib, der sich 2017 in der
Wagner-Welt durch die Wuppertaler Produktion Surrogate Cities / Götterdämmerung einen Namen machte,
als er Heiner Goebbels Orchesterstücke mit dem Schlussakt der Tetralogie koppelte. Mythos und Moderne
kamen schon damals zwanglos zueinander, die Frage nach der Schuld des Menschen und der Rolle der
Städte wurde damals aufgeworfen; nun werden Mythos und Moderne auf spielerische, trotz des schweren
lauten Kampfs viel leichtere Weise nach Bayreuth gebracht. Niemand muss sich fragen, inwiefern er
„Siegfried“ im Herzen ist (auch wenn es zunächst höchst vernehmlich schlägt). Er muss nur einen Kampf
bestehen, von dem er sicher sein kann, dass er ihn nach drei Minuten überlebt hat. Technisch möglich
machten diese im klassischen Sinne reizende Erfahrung Jay Scheibs Leute vom Massachusetts Institute of
Technology (MIT), an dem er Professor ist, „insbesondere des NCSOFT/MIT.nano Immersion Lab Gaming
Program“, als Koproduktion mit NightLightLabs (Los Angeles): dem technischen Direktor Jesse Garrison,
der Chefentwicklerin Kathleen Fox und dem Klangdesigner Davy Sumner. Damit nicht genug: das 3-DModell des Festspielhauses lieferte Ryan Metcalfe mit seinem Team von Preevue (London), nachdem
LoooM (Berlin) das Haus gescannt hatte. Sie alle schufen, heißt es im Programmheft, eine Analogie zu
Wagners Traum vom „unsichtbaren Theater“, aber was sie schufen, ist das genaue Gegenteil von Wagners
Vision. Das Theater ist, weil es so scheint, durch und durch echt, sichtbar, für den Siegfried in einem selbst
auf überreale Weise spielbar. „Das Ziel ist ein noch direkteres Eintauchen in die Fiktion, in die Geschichte
und die Erfahrung der Oper“ – der Plan ging auf. Nur eines fehlte an diesem Nachmittag: die Kinder und
Jugendlichen, die – vielleicht – den Weg zu Wagner durch derartig elaborierte und lustvolle Kurzeinstiege in
Wagners fantastische Welten finden könnten.
GÖTTERDÄMMERUNG: THE THREAD OF FATE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 4)
Festspielpark, 29.7.-25.8. 2021
„Des Seiles Fäden find‘ ich nicht mehr; verflochten ist das Geflecht.“ War es diese Stelle aus der NornenSzene der Götterdämmerung, die Chiharu Shiota den Auftrag verschaffte, für die Festspiele eine
Installation im Festspielpark herzustellen?
Wagner sprach in Zusammenhang mit dem Vorspiel der Götterdämmerung vom „Weltenschicksal-Gespinst“mit Gespinsten kennt sich die Künstlerin von jeher aus, ja: Sie sind das Markenzeichen Shiotas. Wer
Shiotas Arbeiten kennt, weiß, dass ihn Erlebnisse erwarten, die vom Material geradezu provoziert werden,
gleich, ob es sich dabei um tiefschwarze oder um blutrote Wollwebereien handelt, die sich um die
verschiedensten Objekte hüllen. Was dabei herauskommt, wenn Installation auf Oper trifft, konnten die
Zuschauer bereits 2017 bis 2019 am Theater Kiel beobachten, denn, um auf das „Geflecht“
zurückzukommen, mit dem Ring des Nibelungen hatte sie bereits damals zu tun. Ausstattungskunst und
Bühne, Szene und Installation kamen damals hautnah zusammen, und natürlich war die Szene der Nornen
und ihres Seils eine ideale Steilvorlage für die Künstlerin. Vermutlich hatten die Kieler damals die Idee, die
Japanerin zu engagieren, weil sie angesichts des Nornenseils einfach zu nahe liegend war, um ignoriert zu
werden, doch beschränkten sich Shiotas Webkünste nicht auf die eine Szene. Fast alle Bühnenräume dieses
Ring waren erfüllt von ihren beeindruckenden Geweben – bis zu den Drahtgebilden der Körper der Riesen
und Granes, bis zu Fafners schwarzem Wald und Brünnhildes feuerrotem Felsen. Erst mit der Welt der
Gibichungen verschwand das Naturmaterial aus der Szene.
Nun also vollendet sich der Bayreuther Ring 20.21 mit einer Arbeit Shiotas, in der denn doch der Wollfaden
das wesentliche Element ist. Des Seiles Fäden finden sich bei den riesigen Ringen, die sie umschlingen.
„Die rote Skulptur“, sagte Shiota, „verkörpert die Akkumulation von Beziehungen zueinander. Diese
Verbindungen dehnen sich in Zeit und Raum aus, während die Einfachheit des Rings die Einheit,
Unendlichkeit und Ewigkeit symbolisiert“. Hat die Skulptur auch natürliche Grenzen, sind die Laufmeter
der Fäden auch abzählbar, scheinen sich die Räume, die sich durch die Verschlingungen und Ringe bilden,
doch in eine Unendlichkeit zu öffnen, die den Ring des Nibelungen bis heute auszeichnet: bis hin zu
Skulpturen und Installationen, die ihn quasi philosophisch weiterdenken. „Der Faden kann eng sein, sich
verstricken, zuammenziehen oder dehnen, genau wie menschliche Beziehungen“ – dazwischen und dahinter
liegen die Räume, in denen die menschlichen Dramen stattfinden: bisweilen sichtbar, manchmal heimlich.
Während die Konstruktion des Fadenwerks nicht völlig willkürlich laufen kann, aber von der Fantasie der
Fadenwirkerin abhängt, darf der Betrachter an das Wiederspiel von „Bestimmung und Schicksal, freiem
Willen und Kontrolle“ denken – die Frage, ob das Seil, das die Nornen im Vorspiel der Götterdämmerung
halten, wirklich reißen muss, ob sich also, wie Shiota sich fragt, Brünnhildes und Siegfrieds Schicksal
unaufhaltsam ist und endlich im Blut des Todes endet, wird genau von diesen Gegensätzen berührt. Leben
und Tod gehören zusammen, für Shiota sind es die wesentlichen Themen ihrer Arbeit wie auch des
Schlussstücks der Tetralogie, doch auch die Liebe. Ist die Liebe das Schicksal des scheiternden Paars? Die
Ringe, die Chiharu Shiota mit einem roten Fadennetz verbunden hat, weisen auch auf das Feuer hin, das im
Brande Walhalls und der Gibichungenhalle, dieser Repräsentanz der korrupten Menschenwelt, die
Götterburg und die Erde von jenen Mächten säubern soll, die die Liebe bedrohen.
Rot ist auch die Hauptfarbe einer anderen Produktion dieses Ring 20.21. Betrachtet man Chiharu Shiotas
und Hermanns Nitschs Bayreuther Arbeiten von dieser Perspektive aus, bilden sie ein eigenes
farbkünstlerisches Gegengewicht zu den beiden anderen, theatralischen Arbeiten. Zusammen aber ergeben
sie einen Ring, der deshalb so rund ist, weil die einzelnen Abende, Vormittage, Kurznachmittage, Tage und
Nächte mit Loge, der Malaktion, dem Drachenkampf und dem Fadenkunstwerk denkbar verschieden
ausfielen. So gesehen ist nichts so schlecht, dass es nicht für irgend etwas gut ist. Corona hat schließlich
dafür gesorgt, dass einige originelle und schöpferische Künstler der Gegenwart für Bayreuth arbeiteten, die
ansonsten wohl kaum auf und am Hügel in Erscheinung getreten wären.
Frank Piontek, 29.7. 2021
Foto: ©Frank Piontek

